Neulich auf der Arbeit: „In der Backstube stiebt es doch.“
„Was ist „Stieben“ denn für ein Wort?“
„Na, wenn zum Beispiel etwas ins Mehl fällt, dann stiebt das Mehl so hoch.“
„Also Stauben?“
Ist Stieben und Stauben das Gleiche?
Nicht jeder interessiert sich womöglich für die Irrungen und Wirrungen der deutschen Sprache, aber ich musste dem Ursprung des Wortes trotzdem nachgehen und möchte euch an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen. Stieben oder Stauben? Das wollte ich jetzt wissen.
Handelt es sich bei dem guten Wort „Stieben“ tatsächlich um eine vernuschelte, sächsische Variante von „Stauben“ oder hatten die Wörter weniger miteinander zu tun, als der ähnliche Klang vermuten lässt?
Stieben – (Wie Staub) in Teilchen auseinander wirbeln
Der Blick in den Duden bringt mich zum Jubeln: das Wort „Stieben“ ist kein Dialekt, sondern existiert bereits seit dem althochdeutschen in unserer Sprache. Damals sagte man zwar noch „stioban“, aber bereits im Mittelalter sagte jederman „stieben“ (wahrscheinlich „sti – eben“ ausgesprochen).
Stieben bedeutet soviel wie „in Teilchen auseinander wirbeln“. Der Duden setzt „wie Staub“ in Klammern davor. Da hatten wir wieder den Staub. Mein Problem mit diesem ähnlichen Wort ist folgendes: nur Staub kann stauben. In diesem Fall trifft die Bedeutung zu, doch wie sieht es mit Schnee oder Mehl aus. Anderes kann nicht stauben, sondern nur stieben.
Als Synonym passt für mich eher „Aufwirbeln“. Wie sagen Eltern immer: „Pass auf, du stiebst hier alles voll!“ Das ist eine Aufforderung, die fast jedes (sächsische?) Kind kennen dürfte, dass schon mal durch den Dreck gerutscht ist, während der Papa Wäsche aufhängt.
Stieben, stob, gestoben?
Interessanter Weise heißt es im Duden unter Grammatik „starkes, seltener schwaches Verb“, dabei dürfte kaum jemand sagen „Das Mehl stob“ oder „Der Schnee hatte gestoben“. Vielmehr „stiebte das Mehl und der Schnee hatte gestiebt.“ Wie sagt ihr das?
Ich denke, dass starke Verb wurde inzwischen verdrängt. Früher boll auch der Hund, der heute eher bellt. Und der Sand stiebte, der früher stob.
Was sagt die Etymologie dazu?
Wenn man ein Wort ergründen will, schaut man, wie es früher benutzt wurde. Dafür gibt es etymologische Wörterbücher wie den Kluge. Ich habe bei DWDS folgendes gefunden: Das Wort bedeutet „fortwirbeln, umherwirbeln, sprühen“ und wurde im 8. Jahrhundert als „stobian“ in Texten gefunden. Im Mittelalter hieß es dann „stieben“ oder auch „stiuben“.
Spannend: Als Bedeutung wird erklärt, dass Stieben = „als oder wie Staub umherfliegen, Staub von sich geben“ bedeutet. Also landen wir am Ende doch bei der naheliegendsten Erklärung: dem Staub.
Wie das Wort in unseren Wortschatz kam, ist allerdings nicht ganz geklärt. Man vermutet einen griechischen Ursprung beispielsweise von „tȳ́phesthai“, was „rauchen, qualmen, Rauch machen, langsam verbrennen“ bedeutet und dem „tȳphṓs“, dem „Wirbelwind“ oder „Rauch, Dampf, Qualm, Dunst“.
Benutzt ihr das Wort Stieben?
Auch in Bonn schauten mich die Leute etwas irritiert an, wenn ich sagte „Das stiebt aber!“

Das Wort „stieben“ taucht aber zum Beispiel auch in alten Gedichten auf wie hier in „Leonore“ (1773) von Gottfried August Bürger. Wer es nicht lesen kann, darin heißt es:
Und hurre hurre, hopp hopp hopp!
Ging’s fort in sausendem Galopp,
Daß Roß und Reiter schnoben,
Und Kies und Funken stoben.
Noch nicht genug?
Wer einmal mit dem Nachforschen beginnt, der kommt schnell von Hölzchen auf Stöckchen und so ging es am Ende auch mir. Denn mit Staub und Stieben war es nicht getan. Wusstet ihr, welche verwandten Wörter es noch gibt? Na zum Beispiel das Stöbern. Es leitet sich vom mittelalterlichen Wort stöuben ab, das „aufscheuchen, aufjagen“ bedeutet und zum wundervollen Gestöber führt. Nicht Gestieber. Schade.





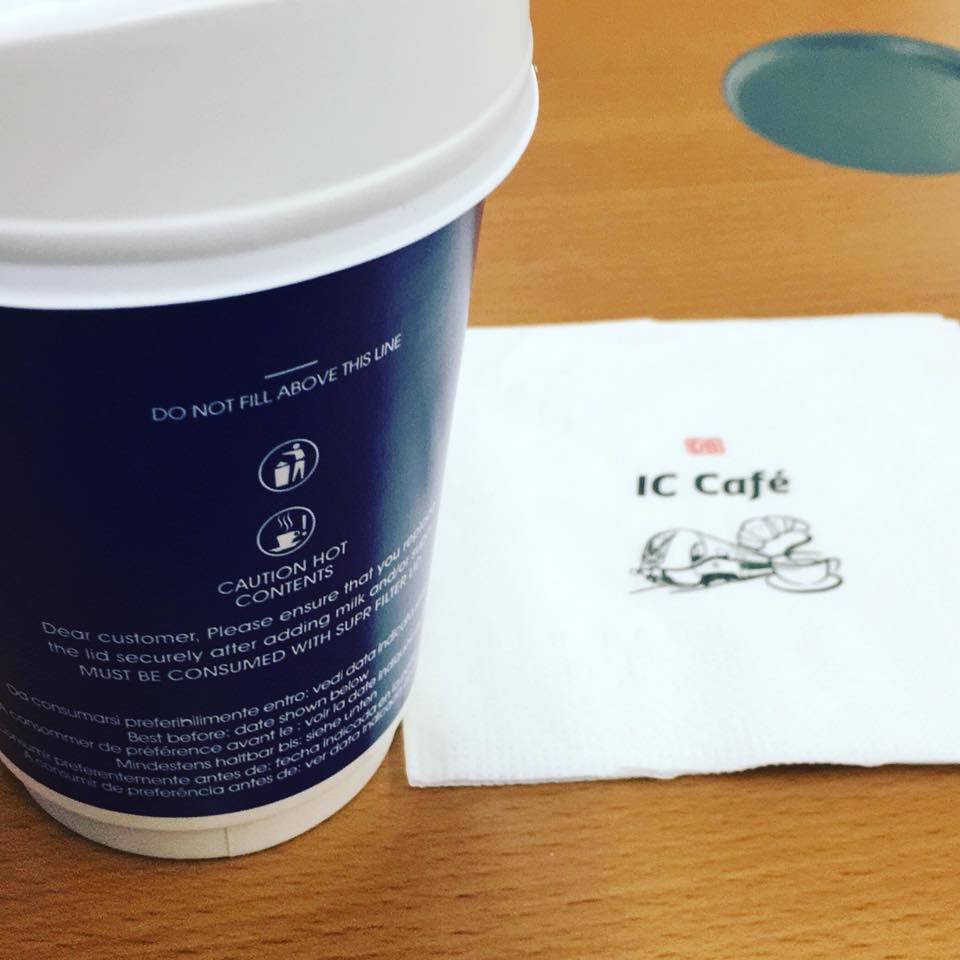

![[CD-Tipp] Unsere Stadt spricht alle Sprachen](https://dresdenmutti.files.wordpress.com/2023/12/sulipuschbanandfriends-unserestadtsprichtdeinesprache-cd-cover.jpeg?w=526)
Hinterlasse einen Kommentar